
DER STREIT UM DAS SCHÖNE – Ästhetik zwischen Natur und Architektur
Bernd Lötsch





























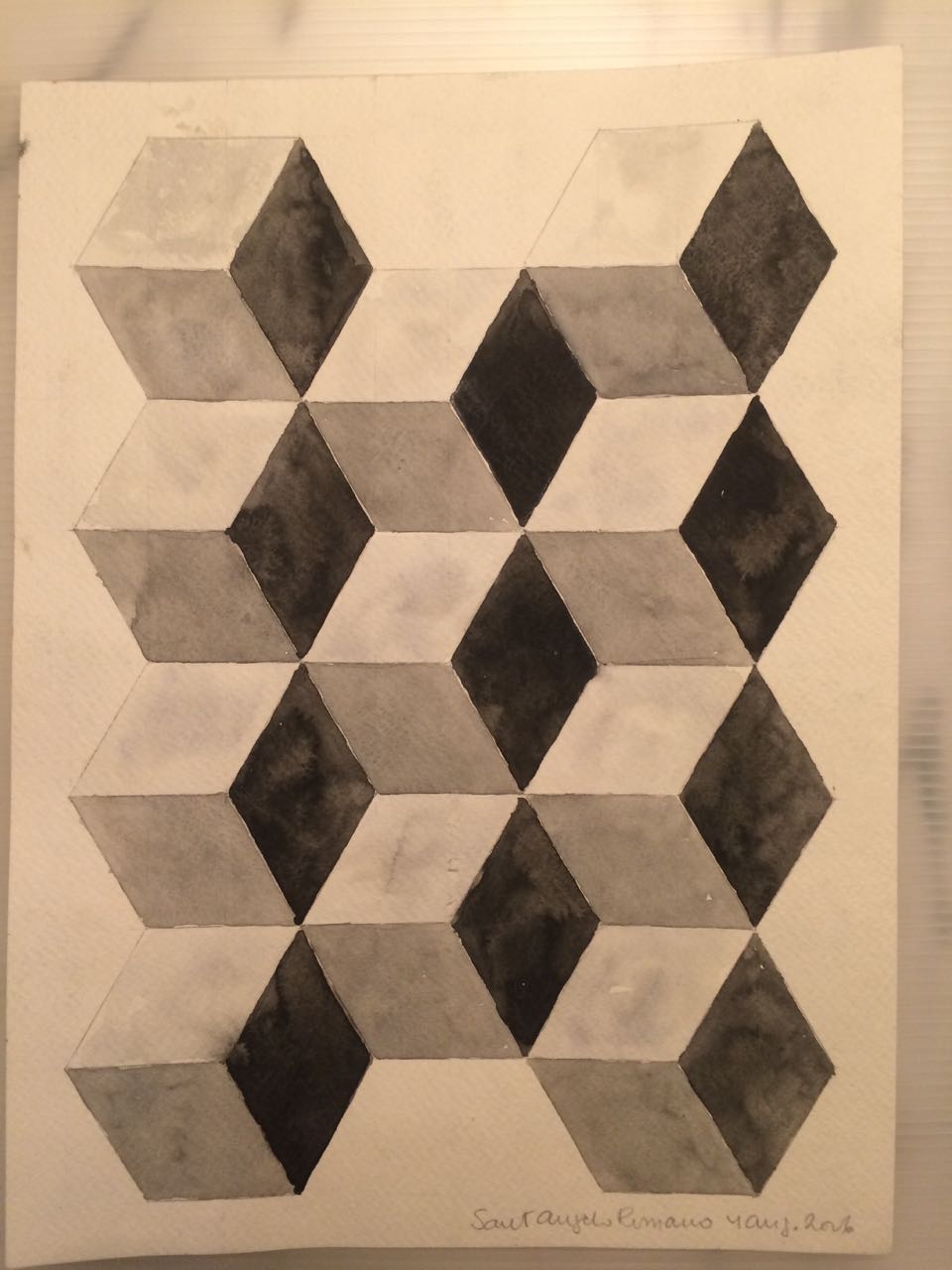









Abstract
Das Credo aller Marketing -und PR Strategen, die inhaltschwangere Abkürzung für das, was sie beim Konsumenten bewirken müssen, AIDA: Attention, Interest, Desire, Action – muß davon ausgehen, daß der Mensch – als das höchstentwickelte Augenwesen der Evolution entscheidend über visuelle Reize zu manipulieren ist. Welche optischen Signale sind die wirksamsten? Welche werden mit Zuwendung beantwortet? (dies gilt schon im Tierversuch als ein Kriterium für ästhetische Wirkung) Ästhetik kommt vom griech. Aisthesis – Empfindsamkeit und lebt auch noch in Anästhesie weiter – unempfindlich machen. Gewiß ist Empfindsamkeit ungleich verteilt – kann aber gefördert, leider auch unterdrückt werden. Was aber hat uns die Natur davon in die Wiege gelegt? Gibt es etwa Maßstäbe für das Schöne, die nicht bloß Intuition, nicht bloß kulturell geprägt sind? Eben weil es so unterschiedliche kulturelle Vorlieben gibt, ist die Frage umso interessanter: gibt es überkulturelle Einigungen auf das Schöne – als menschliche Universalien der Ästhetik?
Vorbemerkung
Ich beschäftige mich nicht mit dem Schönheitsbegriff eines Fäaken beim Anblick eines rosa gefärbten Schinkens, eines Matrosen angesichts eines drallen Mädchens, eines Schimpansen angesichts des östrisch angeschwollenen Hinterteils seiner Artgenossin oder eines Jockeys beim Anblick eines muskulösen Rennpferdes. Diese Präferenzen haben Motive in Triebbefriedigung und Funktionslust. Hinter diesem Schönheitsempfinden verbergen sich Interessen. Kant meinte mit Schönheitsempfinden hingegen „das interesselose Wohlgefallen“, das uns anspringt, obwohl wir im Objekt unserer Zuwendung keinen Vorteil erwarten können, keine Triebbefriedigung- wo der einzige Lohn der schöne Anblick an sich ist, wie bei der Blüte, dem Schmetterling, Pfauenrad Kristall oder Regenbogen.
Anlaß dieser Untersuchung war die erschreckende Verhässlichung aller Lebensbereiche.
Als Stadtökologe wird man zum Grenzgänger zwischen Biologie und Architektur. Man sucht nach ästhetischen Begründungen, die nicht bloß subjektivem Geschmack entspringen. Die Frage, wie weit das Weltbild der Verhaltensforschung zum Problem des Schönen beitragen könnte, fasziniert mich, seit ich Konrad Lorenz kenne.
WIE GOTTLOS IST DIE GERADE LINIE, oder ZWISCHEN CHAOS UND ORDNUNG
Den letzten Anstoß zur Suche nach den angeborenen Grundlagen unseres Schönheitssinnes gab mir die freundschaftliche und doch skeptische Auseinandersetzung mit Hundertwassers ästhetisch angelegter Architekturkritik- der Verteufelung der rechtwinkeligen Kistenmacherei und technischen Monotonie:
Seine Feindbilder waren Adolf Loos, Mies van der Rohe und Le Corbusier – für ihre Reißbrett-Epigonen sind sie bis heute die großen Formgeber. Für Hundertwasser waren sie Formnehmer – weil sie Baugestalt und Stadtbild verarmten und monotisierten bis zur Unerträglichkeit.
„Das Lineal ist das Symbol eines neuen Analphabetentums, das Lineal is das Symptom der neuen Krankheit des Zerfalls. Die heutige Architektur ist kriminell steril. Von Österreich ging dieses Architekturverbrechen in die Welt. Der Österreicher Adolf Loos hat diese Schandtat in die Welt gesetzt… Aber Adolf Loos war unfähig, 50 Jahre vorauszudenken. Der Teufel den er rief, den wird die Welt nun nicht mehr los… Er pries die gerade Linie, das Gleiche, das Glatte.
Jetzt haben wir das Glatte. Auf dem Glatten rutscht alles aus. Auch der liebe Gott fällt hin, denn die gerade Linie ist gottlos“ .Hundertwasser, F. 1968, Los von Loos, In. Schöne Wege, S 174.
Ist Unregelmäßigkeit, Unordnung, krumme Linie, Antigeometrie wirklich schon Rezept für Schönheit? Wie kommt ein natursensibler Künstler dazu, gerade die Gerade zu verteufeln, wenn er nach einer dem Menschen gemäßen Formenwelt sucht?
NATURWESEN MENSCH
Die von Konrad Lorenz, entwickelte Evolutionäre Erkenntnistheorie bestätigt überzeugend, dass Sinnesorgane und Gehirn uns immerhin ein Bild der Wirklichkeit liefern, das „realistisch“ genug sei, um uns zu den kompliziertesten Überlebensleistungen in unserer Umwelt zu befähigen
Unser „Weltbildapparat“ sei durch Auslese im Dialog mit der Natur entstanden und an diese ebenso angepaßt wie Flossen an das Wasser, Flügel an die Luft, Blätter an das Licht oder Wurzeln an das Erdreich, denn sonst könnten Aug‘ und Ohr, Hand und Hirn darin nicht überlebenssichernd funktionieren, operieren und uns orientieren. Der Affe, der keine realistische Vorstellung von dem Ast hätte, auf den er springt, wäre bald ein toter Affe und könnte nicht zu unseren Vorfahren zählen, ist ein Bonmot aus Kreisen der evolutionären Erkenntnistheorie.
Dieser Anpassungsdialog zwischen der Natur um uns und der Natur in uns währte über viele Millionen Jahre, formte jede Faser unseres Wesens, von der Netzhaut bis ins Nervenzentrum. Der Mensch ist in seinem Kern demnach furchtbar altmodisch geblieben, trägt er doch die Spuren seiner biologischen Evolution mit sich, die ausschließlich im Naturmilieu und im Sozialverband von Kleingruppen stattfand. So wird auch heute noch jedes Baby mit der Instinktausstattung des Cromagnon-Menschen geboren („Steinzeitjäger im Straßenkreuzer“).
Die selbstgeschaffene Verfremdung seiner Umwelt läuft nun der Natur des Menschen, seinen in Millionen Jahren entstandenen Anpassungsmustern, davon und erzeugt eine zunehmende Neurotisierung. Würde man die 30 Millionen Jahre Primatenentwicklung von unseren ersten Affenahnen bis zum Homo sapiens gedanklich auf ein Jahr komprimieren, so wäre in diesem Maßstab der Zeitraum seit der industriellen Revolution nicht mehr als die letzten 2 ½ Minuten des gedachten „Primatenjahres“.
Der Mensch ist konstitutionell an reich strukturiertes Gelände mit vielfältiger Pflanzenwelt angepaßt, insbesondere Savannen mit Baum-und Buschgruppen, besonders auch an Wasserrändern. Eibl-Eibesfeldt (1985) spricht gar von ausgeprägter „Phytophilie“ (Pflanzensehnsucht) – wo er kann, holt der Mensch Pflanzenformen in seinen Lebensraum, entweder als lebendes Gewächs in der modernen Wohnhöhle oder – künstlerisch verschlüsselt – vom Acanthuskapitell korinthischer Säulen bis zum floralen Jugendstildekor. Erst der „Funktionalismus“ verbannte die Pflanzenornamentik aus der Architektur und schuf damit bald unbewußte Mangelerlebnisse für das uralte Naturwesen Mensch.
WIEVIEL NATUR BRAUCHT DER MENSCH?
Die Zunahme nervlich seelischer Zivilisationsschäden führen Psychologen auch auf den oft unbewußten Naturverlustschock zurück. Dies ist umso wichtiger, seit man weiß, daß seelische Komponenten an der Entstehung der meisten Krankheiten beteiligt sind. Dies paßt zur Lebenserfahrung eines Wiener Hausarztes „a gsunder Mensch wird net krank“. Der bedeutende Vertreter der Wiener psychosomatischen Schule, Erwin Ringel, faßte es nicht minder treffend „Was kränkt macht krank“. Intensives Naturerleben kann Streß abbauen, die Konzentrationskraft steigern, Blutdruck und Gemütslagen harmonisieren sowie Verspannungen lösen. Nationalparklandschaften tragen dazu bei, die „seelische Hungersnot“des Industriemenschen zu lindern – sie sind nicht nur Biotope“ sondern auch „Psychotope“. Der deutsche Photograph Ehlers beliefert Kliniken mit Postern aus den letzten europäischen Wildnisreservaten – auch aus den Donauauen, da die Ärzte ausgesprochen günstige Wirkungen auf ihre Patienten sehen.
Hundertwassers Bauten z.B. bemühen sich um „optische Naturkonditionierung“ – er wurde zunehmend von Klinikern gebeten, Bereiche für die Patienten zu gestalten.
THESE: NATURFORMEN ALS SEELENVITAMIN – DIE GOTTLOSE GERADE
Die viele Millionen Jahre währende Evolution des Menschen, die seinen sinnlichen Wahrnehmungsapparat und viele seiner seelischen Bedürfnisse formte, hat sich im Naturmilieu abgespielt – einer Umwelt, in der es keine perfekten Geraden oder geometrischen Gestalten gab und gibt.
Im Umfeld eines Papua oder Amazonasindianers konnte man jahrelang leben, ohne einer „gottlosen“ Geraden zu begegnen – ja selbst in den Landschaften Mitteleuropas fällt die gerade Linie sofort aus dem Rahmen, kann der Betrachter sicher sein, daß hier die Technik des Menschen ihre verfremdende Spur gezogen hat. Und der Ökologe weiß zudem, daß diese Geraden dann auch in der Regel zum „Werkzeug des Teufels“ werden.
Die schnurgeraden Trapezprofile der Bachregulierer haben Flußleichen in Betonsärgen hervorgebracht, öde Gerinne, die nicht nur das Auge beleidigen, sondern auch funktionell versagen.
Doch ist die ökologische Kritik an der Geraden lediglich eine späte Bestätigung des künstlerischen Empfindens, wie unnatürlich technisch-geometrische Perfektion sei, Rechtfertigung einer Intuition, die ahnte, daß sich die Ordnung des Lebendigen grundsätzlich in anderen Formen ausdrückt, und daß Tausende Generationen des Menschengeschlechtes vor uns in organisch bestimmten Umwelten aufwuchsen, lebten, liebten und starben, in denen sie niemals einer makellosen Geraden, perfekten Symmetrien oder gar spiegelblanken, geometrischen Großformen begegneten.
Doch zu welchem Schluß berechtigt dies?
Ist es trotz alledem nicht müßig, die Faszination zu leugnen, die von geometrischen Objekten ausgeht?
GEGENTHESE: DER REIZ DES REGELMÄSSIGEN – DIE GÖTTLICHE GEOMETRIE
Erfüllten nicht schon die Ägypter mit ihren – als Weltwunder bestaunten – Pyramiden, einen Menschheitstraum? Ein Widerspruch? Selbst die Natur produziert, dort wo sie „Aufsehen erregen muß“, also optische Signale aussendet, klare Formen, die in gesetzmäßiger Weise aus dem Rahmen organischer Unregelmäßigkeit und verwirrender Zufallsstrukturen ausbrechen. Da tauchen plötzlich recht strenge Symmetrien, simple Ordnungen und einprägsame Farbmuster auf. (Die Biologen sprechen dann von „Plakatfarbigkeit“).
Eben weil der, allen Augenwesen instinktiv vertraute, Normalfall der organischen Natur die Unregelmäßigkeit ist, bedarf es klarer Ordnung als Kontrast, um Aufsehen zu erregen. Deshalb fühlen sich die meisten augenorientierten Organismen in der Unregelmäßigkeit zwar geborgen und angeheimelt – hingegen durch geometrische Ordnung angelockt (deshalb wachsen uns heute die Megakristalle der technomorphen Großarchitektur über den Kopf – als überoptimale Attrappen unserer Ordnungssuche).
Blumen und Rosetten
Eine der erfolgreichsten ästhetischen Wirkungen wird durch Symmetrie, besonders durch Radiärsymmetrie erreicht, von den strahligen Blüten und Blütenständen bis zur strahligen Monstranz des Pfauenrades (bei dem noch „Augensymbole“ hinzu kommen, ähnlich denen auf vielen Schmetterlingsflügeln). Spiegelungen im Wasser sind ein beliebtes Motiv der Landschaftsphotographie, Kaleidoskopbilder faszinieren uns ähnlich wie gotische Rosettenfenster.
Die Blumenpracht ist eine Schaufensterdekoration der Natur – im Wettbewerbsgeschehen der Evolution herausgezüchtet, um Insekten anzulocken – und eben deshalb ist es naturphilosophisch so interessant, daß optische Signale, für deren Entstehung die Anziehungskraft auf die Facettenaugen vorbeifliegender Nektarsucher mit ihren stecknadelkopfgroßen Gehirnen maßgeblich war, auch den Menschen mit seiner ganz anderen Sinneswelt unwiderstehlich anziehen. (Wobei es für wilde Blumen bekanntlich eher Nachteile bringt, daß sie auch dem Menschen gefallen. Andererseits besitzt die Hinwendung zu einer – sagen wir Orchideenblüte – auch für den Menschen zunächst keinen materiellen Vorteil. Oder welchen biologischen Nutzen sollte seine Neigung zum Blumenpflücken haben, welchen Sinn die Emsigkeit mit der bereits Kinder die Geschlechtsteile höherer Pflanzen amputieren und heimtragen?). Es manifestiert sich darin das allgemeine ästhetische Prinzip, daß geordnete Farben und Formen einer ungeordneten oder weniger differenzierten Umwelt vorgezogen werden. Die Schönheitsempfindung ist hier auch schon die Belohnung.
Das gestalterische Prinzip des idealen visuellen Signals beschreibt Lorenz in seiner Vergleichenden Verhaltensforschung (1978) als Prägnanz (ein Begriff von Felix Krüger). Prägnanz heißt: Auffallend und unverwechselbar durch Unwahrscheinlichkeit (der Reiz des Raren) und einprägsam durch Einfachheit, müssen Signale im Gedächtnis, (zum Teil sogar im Genom von angeborenen Verhaltensprogrammen) leicht speicherbare „Markenzeichen“ abgeben.
DIE SUCHE NACH ORDNUNG – den Augenwesen angeboren
Dies erklärt auch, warum augenorientierte Tiere ästhetische Ordnungen dieser Art aktiv suchen. In Wahlversuchen mit Affen, Waschbären, Dohlen und Krähen zeigte B. Rensch (1957, 1958), daß die Tiere regelmäßige Formen den unregelmäßigen und Symmetrie der Asymmetrie vorziehen. Dieselben Muster werden von Menschen schon auf Kindheitsstufe ästhetisch höher eingestuft als regelose, unsymmetrische, nicht parallele Muster.
Unsere Wahrnehmung bemüht sich ferner, Ordnung in den visuellen Erscheinungen herzustellen. Bieten wir dem Auge für den Bruchteil einer Sekunde ein Dreieck, dem eine Spitze fehlt, dann sehen wir ein ganzes Dreieck. Asymmetrie und andere Unregelmäßigkeiten in einfachen geometrischen Figuren werden von der Wahrnehmung ausgeglichen. Wir ergänzen d.h. idealisieren in Richtung auf Regelmäßigkeit und Symmetrie.
Die Faszination, die regelmäßige Kristalle für uns haben – je regelmäßiger die Prismen, desto höher der Sammlerwert – erklärt sich aus eben jenen Bezirken unserer Wahrnehmung. Dürers berühmter Kupferstich „Melancholie“ (1514) lebt vom reizvollen Kontrast zwischen einem fast geometrisch perfekten Kristall und der organischen Formenwelt des späten Mittelalters. (Die Albertina wählte eine dieser Kristallflächen sogar als Schriftgrund für ihr Ausstellungsplakat.)
Daß gerade Naturvölker diesem für sie so seltenen Reiz erliegen, zeigen die Berichte von Forschungsreisenden aus dem vorigen Jahrhundert, die sich um (wertlose) geschliffene Glaskristalle bei den Eingeborenen kaufen konnten, was sie wollten.
Auf meine Bitte hin machten I. Eibl-Eibesfeldt und C. Sütterlin mit Kindern von Naturvölkern Wahlexperimente zwischen Kristallen (Pyrit, Glas) und organischen Formen (schöne Meeresschnecken, kleine Tierplastiken). Sie fanden eine überwältigende Präferenz für die anorganischen glänzenden geometrischen Kristalle. Die Naturkinder suchten gerade jene Rarität, die ihnen die Natur – wenn überhaupt je – nur ausnahmsweise bot.
Auf das Seltene zu reagieren kann durchaus sinnvoll sein. Alles, das süß schmeckte, brachte unseren wilden Ahnen, ohne daß sie es wußten, zugleich auch Vitamine.Das Süße signalisiert die Natur oft durch „glänzend, rund kontrastfärbig“ (Kirsche, Eiben Arillus, Beerenobst).
Die Suche nach dem Salzigen, das unsere Primatenahnen nur ausnahmsweise fanden, ergänzte den Ionenhaushalt, sicherte das Na+ und Cl- Inventar ihrer Körperflüssigkeiten. (Wie heute noch die Salzlecke für das Wild.)
Doch was der Mensch sucht, wird leicht zur Sucht.Salz ist heute billig und unbegrenzt vorhanden. Die zivilisierte Menschheit frißt sich fallweise krank an Salz, meinen Herzkreislaufspezialisten.
Ebenso frißt sie sich mitunter krank an Industriezucker, meinen Ernährungsfachleute und Internisten.Und ebenso fressen wir uns heute krank an Geometrizität, an „Gottlosen Geraden“, die sich der Mensch erst im Industriezeitalter perfekt und unbegrenzt verschaffen konnte.
Bei Hundertwasser liest sich das dann eben so:
„Schon das Bei-sich-Tragen einer geraden Linie müßte zumindest moralisch verboten werden. Das Lineal ist das Symbol des neuen Analphabetentums…
…Vor nicht allzu langer Zeit war der Besitz der geraden Linien ein Privileg der Könige und der Gescheiten. Heute besitzt jeder Depp Millionen von geraden Linien in der Hosentasche“.
Hundertwasser, 1958, Verschimmelungsmanifest In: Schöne Wege, S 165, ff)
Schon 1958 erkannte der Maler, daß Maschinenästhetik, Industriedesign und technomorphe Architektur unseren Sinnen ein gigantisches Gefängnis aus Geometrizität gebaut haben. Was die Natur in kleinen Dosen als Ausnahme bereithält, haben wir in nur wenigen Jahrzehnten zum Normalfall unserer visuellen Umwelt gemacht. Das Rare wurde zur Regel, die faszinierende Einzelerscheinung zum phantasietötenden Massenprodukt.
Der Wilde, der fasziniert nach den Glasperlen greift, würde nach kurzer Zeit aus den gigantischen Glasprismen und blanken Metallkuben reuig in die vertraute Wildnis zurückkriechen. Und selbst der Industriemensch holt immer mehr Dschungelpflanzen und Epiphytenäste in seine technoiden Kristallhallen. Der kleine Asphaltkümmerer im 11. Stock des monoton gerasterten Wohnsilos träumt, wie alle Kinder vor ihm, von windschiefen Knusperhäuschen, Moos und Wurzelmännchen.
STÖRSTELLEN – „Kaugummi fürs Gehirn“?
Die Spannung zwischen Ordnung und Unordnung bestimmt unsere visuelle Umwelt, wie die Spannung zwischen Kultur und Natur unser ganzes Erleben beherrscht. Unser Wahrnehmungsapparat sucht nach Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen. Ebenso wie er annähernd Regelmäßiges im Geist zu geometrisch Perfektem ergänzt, so idealisiert er annähernd Gleiches zu perfekter Gleichheit: eine Verrechnungsleistung des Gehirns, die Anwendung sucht (ähnlich wie die Fähigkeit zum Gestaltsehen, die dann auch auf Wolken und Berge angewendet wird). Bietet man perfekte Geometrie und Stereotypie im Übermaß, langweilt sich unser Wahrnehmungsapparat. Aug‘ und Hirn entbehren die reizvolle Herausforderung, die uns leichte Unregelmäßigkeit sonst bietet.
RHYTHMUS STATT STEREOTYPIE
Die rhythmische Wiederholung gleicher (nicht identer) Teile ist ein wesentliches Konstruktionsprinzip und Erkennungsmerkmal des Lebens – man denke an Zellstrukturen, an Raupen oder Fiederblättchen; häufig wird rhythmische Wiederholung auch als visuelles Signal entwickelt, um aufzufallen (vgl. die Streifenmuster von Korallenfischen, Wespen, u.v.a.m.).
Deshalb sprechen Tier und Mensch auf solche Strukturen positiv an, wurde Wiederholung zum Gestaltungsprinzip dekorativer Kunst – von der Perlenkette bis zum klassischen Ornament des „laufenden Hundes“ oder den gestickten Borten aller Zeiten und Völker. Säulenordnungen, Arkaden, Alleebäume, Menschen in Reih und Glied drücken die formale Freude an rhythmischer Wiederholung aus. Natur und Handwerkskunst garantierten jedoch stets eine leichte Unregelmäßigkeit, die Einheitlichkeit konnte nie zur Monotonie, der organische Rhythmus nie zur technischen Stereotypie verkommen. Die Vielfalt in der Einheit wurde manchmal auch bewußt kultiviert – man denke nur an die Kapitelle mittelalterlicher Kreuzgänge.
Erst maschinelle Massenfertigung ermöglichte eine exakte Vervielfältigung, der sich Natur und Handwerk nur asymptotisch genähert hatten, ohne sie je zu erreichen. So groß war des Menschen Stolz auf diese Leistung und so groß der anfängliche ökonomische Erfolg, daß wir lange nicht bemerkten, wie sehr wir uns die visuelle Umwelt damit verödeten, wie kalt und wesensfremd alles um uns wurde.
Erst heute, rund vierzig Jahre nach Hundertwassers ersten Protesten gegen tödliche technische Sterilität, Gleichheit und Glattheit, gegen die mörderische Monotonie industrieller Massenproduktion, beginnt ein Teil der Menschen aus der Narkose der Stereotypie zu erwachen. Ja, mehr noch, industrielle Eternitschindelhersteller beginnen, diese nach Computerprogrammen mit künstlicher Patina zu variieren, um sie für Altstadtensembles lebendiger zu gestalten.
WARUM IST GOTIK SCHÖN? WARUM RADIOLARIEN UND BAUMKRONEN?
Hätten wir in der Bautechnik auf kühne statische Konstruktionen solange warten müssen, bis es auch möglich sein würde, sie wissenschaftlich zu durchschauen und vorauszuberechnen, hätte es keine gotische Architektur gegeben. Denn lange vor der rechnenden Statik fanden die gotischen Meister zu atemberaubenden statischen Lösungen, indem sie eine „Kraftlinienarchitektur“ aus organischen Skelettformen erstehen ließen (wie wir sie in der Natur überall dort verwirklicht finden, wo es darum geht, mit einem Minimum an Material ein Maximum an Stabilität zu erreichen). Ein künstlerisch anregendes Beispiel sind auch die mikroskopisch kleinen Radiolarien, einzellige Meeresplanktonten, nicht größer als Staubkörner, die schon von Ernst Haeckel als „Kunstformen der Natur“ bezeichnet wurden, weil sie aussehen, als hätten gotische Meister sich dort ihre Inspirationen geholt. Wegen ihrer schwebenden Lebensweise müssen die Kieselgerüste so filigran wie möglich sein — wie es ja auch das Ideal der Domsteinmetze war, ihre Steingebilde zu „entschweren“. Das Motiv der Baumeister dafür war die damals aufkommende „Lichtmystik“, welche den Kirchenraum — magisch lichtdurchflutet — als Abbild des Himmels sehen wollte: „Batir avec la lumiere“ (‚Bauen mit Licht‘ nannte Abt Suger das Grundthema seiner Architektur).Deshalb war es erforderlich, die Baukörper transparent erscheinen zu lassen, ihre Steingebilde zu „entschweren“, zu schwebenden mineralischen Skeletten mit ihren, dem Organischen entstammenden Gestaltsprinzipien.
Der Anschliff eines Oberschenkelknochens läßt in seinem Inneren entsprechend den Drucklinien die Spitzbogenarchitekur eines gotischen Kirchenschiffes erkennen. Selbstverständlich gelten „gotische“ Kraftlinienkonstruktionen für viele Pflanzenstrukturen — etwa Stengelquerschnitte, die aussehen wie Turmgrundrisse. Ein über einer Straße sich schließender Buchenwald erweckt den Eindruck eines Domes.
Die faszinierenden Übereinstimmungen von Naturobjekt und Menschenwerk ergeben sich aus der Befolgung organischer Form- und Funktionsgesetze, die vom Baumeister durch bewußte und unbewußte Naturerfahrung intuitiv erfaßt und in die Architektur übertragen wurden. Eben dies ist auch der Grund für ihren ästhetischen Reiz. Dies gilt auch für andere gesetzmäßig aufgebaute Strukturen der Natur.
Im Prinzip ist der Baum, das Flußdelta, das Adernetz und die Bronchialverästelung ein verlangsamter Blitz – verlangsamt um den Faktor 1012 aber ungemein ähnlich in Verzweigung und Raumerfüllung.
Sie alle sind fraktale Gebilde — sie folgen dem Prinzip der Selbstähnlichkeit — d.h. die kleinsten Verästelungen ähneln dem Ganzen, der einzelne Zweig der ganzen Krone – selbst ein Förster könnte getäuscht werden, würde man einen Kronenast als Jungbaum in den Boden rammen.
Seit Benoit MANDELBROT (IBM Forschung), vermögen wir das „deterministische Chaos“ mathematisch zu beschreiben:
* deterministisch, weil einem (oft erstaunlich) einfachen Gesetz gehorchend
z.B der Formel Z2 + c, welche in aufeinanderfolgenden Schritten (Iterationen) immer wieder angewandt, schließlich zu hochkomplexen Gebilden der Selbstähnlichkeit führt — analog den aufeinanderfolgenden Teilungsschritten und Wachstumsschüben lebender Systeme.
* Chaos, weil die feinen Details — die tatsächliche Lage einzelner Verästelungen — prinzipiell nicht vorhersagbar sind. Jeder Förster kennt die Gestalt einer Eichen- oder Schwarzpappelkrone. Wo aber genau sich die Krone des Jungbaumes in 10 Jahren verästeln, wo jeder Sproß sitzen wird, ist prinzipiell nicht vorhersagbar (weil Folge zahlreicher Rückkoppelungen).
Solch fraktale Systeme hoher Selbstähnlichkeit lösen aus sich heraus schwierigste Probleme der Logistik — z.B. der Versorgung von Geweben und Organen. In unserem Körper ist keine Zelle weiter als 3 – 4 Zellen von der nächsten Blutkapillare entfernt, obwohl unser Adernetz nur 5 % des Körpervolumens ausmacht. Auch unsere Bronchien leisten durch fraktale Verästelung auf kleinstem Raum, eine innere Oberflächenvergrößerung, die der Fläche eines Tennisplatzes entspricht. Auch anorganische Kräfte — wie etwa der Abtragung, Verwitterung, Erosion — sind fraktal darstellbar, weshalb man mit dem Computer Gebirge konstruieren kann: Landschaften, die es nie gab, die es aber hätte geben können.
SCHÖNHEIT DER FUNKTION
Zweifellos also gibt es Schönheit als „Nebenprodukt“ von Funktion – vor allem im Bereich des Lebendigen; unser Gehirn erkennt in allen biologischen Formen vertraute Prinzipien wieder, und doch geht ein technisch-kommerziell eingeengter Funktionalismus am Wesen der Schöpfung vorbei. Er reicht nicht aus, die Vielfalt und Schönheit der Natur zu erklären, denn:
Die Zahl der Formen ist größer als die der Funktionen.
Allein Costa Rica hat 1400 Orchideenarten, deren tausenfältige Blütenvielfalt auch nichts anderes erreicht als ein Gänseblümchen – nämlich die Bestäubung. Es muß im Leben doch nicht alles funktional sein, soferne es nicht antifunktional, also funktionsstörend ist, (das heißt: Geduldet wird, was keine Überlebensnachteile bringt).
Die Natur schafft nicht wie ein Ingenieur, sondern wie ein verspielter Künstler
Am deutlichsten wird das „spielerische Formenwerfen“ der Evolution dort erlebbar, wo die Natur kunst-analoge Werke schafft, also kommunikative Zeichen setzt, ästhetisch lockt und „Werbegraphik“ betreibt. Der Begriff „analog“ meint hier „funktionsgleich“ (im Unterschied zu „entstehungsgleich“, „homolog“) — denn wie definiert die moderne Humanethologie die Bildende Kunst (und nicht nur diese, auch die Darstellende Kunst)? „Gestaltung mit Ausdruckswillen“(bei Eibl-Eibesfeldt ‚Einsatz ästhetischer Mittel im Dienste der Kommunikation“.
Diese Definition trifft auf den Großteil künstlerischen Schaffens aller Völker und Epochen zu. Selbstverständlich müssen daneben — besonders für das 20. Jahrhundert — noch andere Kunstauffassungen gelten. Aber hervorragende Werbegraphik wäre in diesem Kontext „Kunst“ — und die Entwicklung visuell (oder akustisch) „starker“ Zeichen und Signale in der lebenden Natur in diesem Sinne „kunstanalog“.
SCHÖNHEIT ALS FUNKTION
Bei Sonnenblume und Orchideenblüte, Schillerfalter und Tagpfauenauge, Flaggenbuntbarsch, Neonsalmler, Clown- und Picassofisch, Farbfrosch und Feuersalamander, Eisvogel, Mandarinente und Ara ist Schönheit nicht Nebenprodukt von Funktion: Hier wird Schönheit zur Funktion – denn nur das „starke“ optische Signal kann Locken und Warnen – sogar über Artgrenzen hinweg.
Und kein anderes Organ – und sei es noch so wichtig – darf die ästhetische Funktion (heißt hier starke visuelle Wirkung) stören. Eine scheinbar totale Umkehr des funktionalistischen Dogmas.daß Form der Funktion zu folgen habe. Denn, daß man Schönheit um der Schönheitswirkung willen schaffe, galt lange Zeit als überholt. Wiewohl auch dies nur an der Oberfläche galt. Die tieferen Antriebe der Neuen Sachlichkeit waren nämlich stets alles andere als sachlich. Dies zu erkennen, gewährt uns erst die historische Distanz.
Die These „Kunst als Ästhetik mit Kommunikation“ gilt auch für die Architektur. Neben der ästhetischen Faszination der Megakuben aus Glas und Metall (obzwar auf die unterste, primitivste ästhetische Empfindung abzielend) spricht ihr „Technobrutalismus“ eine künstlerische Sprache — eine Botschaft vermittelnd, die einst viele Techniker berauschte – genau jene Botschaft, die wir heute nicht mehr ertragen: Ausdruck von Präpotenz, welche die Machbarkeit aller Lebensbereiche zugrunde legt, an den Endsieg der Technik über die Natur glaubt, ohne zu begreifen, daß wir uns dann auf der Verliererseite wiederfinden würden – pathetische Formensprache des Zeitgeistes der 60er und 70er Jahre, eines Zeitgeistes, der dieser Biosphäre nur allzu bald das Leben kosten könnte.
DIE NEUE DÜRFTIGKEIT
Bereits in seinem 1948 geschriebenen „Verlust der Mitte“ sah der Kunsthistoriker Hans Sedlmayr den Tick einer ganzen Architekturgeneration voraus, wie sie Merkmale von Maschinen, Eisenbahnwaggon, Flugzeugen, auf Häuser überträgt, Heizungsröhren und Lüftungsschächte, hochglanzpoliert, als beherrschende Gestaltungselemente zur Schau stellt. Kahle Nacktheit wird zur Tugend – „Pathos des Sachlichen“. Die Vergötzung von Maschinenteilen am Bau als künstlerische Fratze der Technokratie. Anbetung des Zwecks – Verlust des Sinns. („Technology is the answer – but what was the question?“).
ZWISCHENBILANZ
Bestimmte visuelle Eindrücke gelten in verschiedensten Kulturen übereinstimmend als „schön“. Sie sind in Schmuckdesign, Bildender Kunst und Werbegraphik erfolgreich, z.B. Blüten und Schmetterlinge (Werbegraphik der Natur mit Radiär- und Bilateralsymmetrie und plakatfarbigem Kontrast), Spiegelsymmetrien, Kaleidoskope, Kristalle, rhythmische Wiederholung, spektrale Farbfolgen (von irisierenden Strukturfarben bis zum Regenbogen), Faszination des (scheinbar) Unnatürlichen (z.B. Geometrie, Metallglanz, Leuchtorganismen). Was haben diese Elemente gemeinsam ?
Simple Ordnungen,Spiegelsymmetrie, Radiärsymmetrie, Geometrizität, auffallend durch Kontrast und Seltenheit, einprägsam durch Einfachheit. Diese bereits auf augenorientierte Tiere und Kinder stark wirkenden Prinzipien sind seit längerem erkannt (z.B. E. Haeckel, E. Gombrich, I. Eibl E, B. Lötsch).
Doch erklären diese nicht die Schönheit von Flußmäandern, Bergen und anderen Erosionsformen, Faltenwürfen, Strömungsbildern und Stromlinienformen, Pflanzengestalten mit ihren Verjüngungen und Verästelungen, Farbschlieren in einer Küvette und Regenbogenspektren.
Dies führte zu scheinbar unüberbrückbaren Konflikten zwischen Schönheitssuchern verschiedener Schulen. Die einen betonen die Bedeutung strenger Ordnungen für Ornament und Architektur (das griechische „Kosmos“ steht für Ordnung ebenso wie für Schmuck, Verschönerung, welch letztere Bedeutung noch in „Kosmetik“ weiterlebt)
Die Gegenposition hielt Hundertwasser mit seiner These von der „gottlosen Geraden“ und seiner fast kompromisslosen Anbetung des Unregelmäßigen als Basis organischer Schönheit. Ernst Haeckel wundert sich bereits in seinen „Kunstformen der Natur“ (1899-1904), daß alle von ihm als hochwirksam erkannte ästhetischen Prinzipien wie Symmetrie und Geometrie ausgerechnet in der ästhetischen Betrachtung von Landschaften versagen, ja Geometrie und Gerade dem feineren Geschmack ästhetischer Betrachter in der Natur unerwünscht sind.
Der gemeinsame Nenner, so das Ergebnis dieser Studie findet sich in einer konsequenten Weiterführung von Ansätzen der Evolutionären Erkenntnistheorie:
2) Ablesbare Gesetzmäßigkeiten – erkennbare Spuren formender Kräfte
Die über simple Ordnungen und Kontraste hinausgehenden Elemente der „höheren Ästhetik“ wirken auf die Fähigkeit des Menschen zum „denkenden Schauen“, die ihn zum Erfolgstyp der Evolution werden ließ: sein rastloses Erspüren von Ursache und Wirkung, seine Suche nach Gesetzmäßigkeiten, nach Sinn und Bedeutung aller Erscheinungen. Sie verlieh diesem Werkzeug- und Feueraffen Macht – nämlich Vorhersagbarkeit. Seine Umwelt wurde prognostizierbar – damit beherrschbar. (Das Erkennen von Causalität ist einer der Schlüssel).
Gestalten, welche die Wirkung formender Kräfte verraten, erzeugen in ihm Wohlgefallen – sei es die ablesbare Statik von Pflanzenkörpern, eleganten Brücken oder Kathedralen, die ablesbaren Stromlinien von Fischen, Schiffen, Vögeln und Flugzeugen, seien es die Wechselwirkungen von Wind und Sand in den Dünen der Sahara, Faltungen von Stoffen, ja von geologischen Schichten zu Gebirgen, seien es die rhythmischen Schlingen eines Flußmäanders, seien es die gesetzmäßigen Farbfolgen eines Regenbogens, sei es das erahnte Gesetz logarithmischer Spiralen, die zugleich Wachstumsgesetze ausdrücken können, sei es als simpelster Sonderfall des Gesetzmäßigen die ablesbare Ordnung geometrischer Gebilde und Symmetrien oder als komplexer Fall erahnter Ordnung die (errechnete!) Schönheit fraktaler Computergraphiken.
Die Befriedigung unserer Ordnungssuche ist am höchsten, wenn unser Wahrnehmungsapparat dabei Unregelmäßigkeiten und Störungen wegfiltern, wegrechnen mußte, um das reine Prinzip herauszudestillieren. So ist Rhythmus (die Wiederholung von Ähnlichem) reizvoller als Stereotypie (monotone Wiederholung von Identem). Am interessantesten sind optische Erlebnisse, an der Grenze von Ordnung zum Chaos, wo Vorhersagbares in Unberechenbares umschlägt.
Augenwesen Mensch
Der Mensch kann durch visuelle Schlüsselreize, Auslöser, überoptimale Attrappen in der Verkaufswerbung beinahe beliebig manipuliert werden, solange er nicht durch Bewußtmachung der ethologischen Grundlagen psychische Gegenstrategien entwickelt.
Das Auge des Menschen ist aber nicht nur Reizempfänger, sondern auch Sender, es kann nicht nur sehen, sondern schauen, es ist Sinnes- und Ausdrucksorgan zugleich. Nicht von ungefähr heißt unser Antlitz „Gesicht“.
Die starke Wirkung von Iris und Pupille wird in Gebrauchs- und Werbegraphik für Firmenzeichen und Signale und meist unbewußt auch in Motiven der Volkskunst vielfältig eingesetzt.
Das englische Wort „window“ heißt wörtlich übersetzt „Wandauge“ (Wand kommt von winden – wie auch das Wort „Gewand“, weil die Hausmauern ursprünglich meist Astgeflechte mit Lehmverputz waren), das alte Wort „ow“ für Auge lebt auch wohl noch in „owl“, der Eule, einem der ausdrucksvollsten Augentiere weiter. „wandauge“ erinnert an die Ausdruckskraft von Fenstern, wie ja überhaupt „Fassade“ von face – Gesicht – kommt. Die menschliche Fähigkeit zum Gestaltsehen sieht dann auch in Hausfassaden Physiognomien, die freundlich oder abweisend sein können, Formwerte, die von der Architektur des 20. Jhdts. grob vernachlässigt wurden – ein weiterer Aspekt des Verlustes menschlicher Maßstäbe.
UNBENANNTES ZÄHLEN – GESTALT STATT RASTER
Eine Eigenschaft, die der Mensch mit anderen Kleingruppenwesen teilt, ist seine Fähigkeit zum „unbenannten Zählen“: Dohle, Eichhörnchen oder Mensch können gleichermaßen fünf, sechs oder sieben Punkte auf einen Blick unterscheiden, ohne zu zählen.
Die Ansammlung gleicher Elemente über die Zahl neun hinaus erfordert Nummerieren und Abzählen (oder Anordnung in Gestalten – vgl. 8, 9, 10 auf Spielkarten). Die stereotype Wiederholung – etwa gleicher Bauteile über die Zahl 9 hinaus (schmucklose, monoton gerasterte Fassaden) – führen bei Tier und Mensch in ähnlicher Weise zu Orientierungsverlust.
Nirgendwo in der Natur gibt es die Wiederholung völlig identer Fertigteile wie im Industriemilieu. Jedes organisch gewachsene Element ist prinzipiell einmalig, Baumgestalten sind mitunter ausgesprochene Orientierungspunkte.
An technischen Großstrukturen hingegen, etwa an horizontal aufgehängten Sprossenleitern, kann man beobachten, wie sich Tiere durch die Stereotypie irren – dieselbe Amsel etwa beginnt an verschiedenen Stellen nebeneinander mit dem Nestbau, aber auch Kinder in modernen Berliner Mietskasernen oder normierten Reihenhaussiedlungen Finnlands hatten Schwierigkeiten, heimzufinden. Berliner Kinder halfen sich in einem näher untersuchten Fall damit, die vor den Eingängen stehenden Mülltonnen zu durchwühlen, da sie den elterlichen Haushalt an den Abfällen erkannten.
„Massenbehausungen zu Hunderttausenden… die nur an ihren Nummern voneinander unterscheidbar sind und den Namen ‚Häuser‘ nicht verdienen, da sie bestenfalls Batterien von Ställen für Nutzmenschen sind,…“ (Lorenz, 1973, S. 23).
Ästhetik zwischen Natur und Kultur
Die Natur unserer Ästhetik verlangt keineswegs nur nach der Ästhetik der Natur! Deshalb kommt man in der Bio-Ästhetik mit einer „Ideologie des Natürlichen“ nicht sehr weit. Sie bleibt immer nur Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist der Reiz des Raren, die Anziehungskraft des Unnatürlichen, Künstlichen. Die Natur selbst bedient sich oft sogar ausgesprochen „unnatürlicher“ Effekte, um Aufsehen zu erregen: Von „metallischen“ Interferenz- und Schillerfarben bis zur „Lichtreklame“ von Leuchtorganismen.
Eben weil uns Kristallisches, Metallisches und Geometrisches als Kontrast zum Organischen seit jeher so fasziniert, sind uns diese Elemente technokratischer Architektur über den Kopf gewachsen (sie appellieren an die unterste primitivste Ebene ästhetischen Empfindens)
Der Pendelschlag zum Organischen ist heute eine lebensnotwendige geistesgeschichtliche Reaktion auf dem Weg zu einer neuen Baukultur. Sie wird aus einer Neubewertung des Handwerklichen, einer neuen Ehrfurcht vor der Natur um uns, Kenntnis der Natur in uns und Respekt vor den zeitlosen Werten gewachsener Kulturen kommen müssen, denen wir letztlich unser Menschsein verdanken. Denn – wie definiert Konrad Lorenz (mit Arnold Gehlen) den Homo sapiens? Als „Kulturwesen von Natur aus“.
Damit ist er auch das Wesen mit dem fallweise natürlichen Hang zum Unnatürlichen.
Während eine rettungslos rückständige Avantgarde die Schönheit fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser, weisen K.Lorenz , E. Gombrich, I. Eibl-Eibesfeldt und die neuen Aspekte dieser vorliegenden Arbeit den Weg zum Verständnis wesentlicher „Vokabeln des Schönen“, die jeder Planer und Designer, Marketing – und PR Stratege kennen sollte – während sich Architekten in einer trotzigen Subkultur technoider Minimalisten einigeln und das unter Verbrauch von Milliarden und Zerstörung gewachsener Urbankulturen.
Bildquellen: Helga Fassbinder,
